Geht alles gar nicht
Dass sich Kinder und Karriere vereinbaren lassen, ist eine Lüge. Zeit für mehr Ehrlichkeit
VON HEINRICH WEFING UND MARC BROST
Sind wir gerne Väter? Ja, absolut, von ganzem Herzen.
Sind wir gerne Journalisten? Ja, leidenschaftlich gerne.
Und, geht beides zusammen?
Die übliche Antwort lautet: Ja, klar. Manchmal hakt es ein bisschen,
manchmal sind alle ein bisschen erschöpft – Vater, Mutter, Kinder.
»Urlaubsreif« nennen wir das. Aber im Großen und Ganzen? Gibt es kein
Problem. Wir sind ja prima organisiert, im Job und zu Hause, wir sind
diszipliniert, wir wollen, dass alles klappt. Also klappt es auch,
irgendwie.
Die Wahrheit ist: Es ist die Hölle.
Sonntagmorgen, irgendein Bolzplatz in Deutschland. Fußball mit anderen
Vätern und deren Kindern. Der eigene Sohn hat sich die ganze Woche
darauf gefreut. Man selbst auch. Und dann steht man auf dem Platz und
spielt irgendwie mit, aber eigentlich ist es nur eine Hülle, die da
spielt, denn die Gedanken sind ganz woanders. Bei der Mail des
Vorgesetzten, die kurz vor Spielbeginn angekommen ist. Beim nächsten
Interview, am Montagmorgen. Und dann kommt man nach Hause und fragt
sich, warum es schon wieder nicht möglich war, sich wenigstens diesmal
vollständig einzulassen auf das Spiel; warum man nicht abschalten
konnte.
Aber dann liegt da das Smartphone, und sein rotes Lämpchen blinkt
unaufhörlich, also greift man danach und liest und fängt an zu tippen.
Und hört gar nicht mehr, wie der Sohn fragt, ob man das Tor gesehen
habe, das er vorhin geschossen habe. Jede Mail, jede schnell
geschriebene SMS ist ein kleiner Verrat: wieder eine Minute, die man für
die Arbeit geopfert hat, obwohl man an diesem Wochenende versprochen
hatte, wirklich nur für die Familie da zu sein.
Sogar Sigmar Gabriel nimmt sich doch jetzt Zeit für seine Tochter, holt
sie mittwochnachmittags aus der Kita ab und braust dafür mit Chauffeur
und Personenschützern nach Goslar. Wenn der das schafft, warum dann
nicht wir?
Also tüfteln wir mit unseren Partnerinnen einen Plan aus, gleichen die
Terminkalender ab, die Woche im Halbstundentakt. Wer kümmert sich wann
um die Kinder? Wer bringt sie zum Geburtstagsfest des Freundes? Wer
fährt sie am Wochenende zum Turnier? Hier quetschen wir noch eine Stunde
Sport rein, donnerstags geht sie zum Chor, da musst du um sieben da
sein! Die Familie wird zur Fahrgemeinschaft, aus Paaren werden Partner
in der Logistikbranche.
Und wenn wir übermenschlich diszipliniert wären, keine einzige
Besprechung mehr überziehen würden, nie länger am Telefon hingen als
unbedingt nötig, nur noch die superwichtigen Abendtermine wahrnehmen
würden, dann, ja dann könnte das auch wunderbar klappen. Nicht
vorgesehen im Wochenplan ist allerdings: dass ein Kind Grippe hat. Dass
der Wagen nicht anspringt. Dass ein Zug sich verspätet. Dass auch die
supereffizienten Eltern mal verschlafen oder krank werden. Auch nicht
vorgesehen ist: Zeit für sich. Zeit zu zweit. Aber das ist ja nicht so
schlimm. Wir wissen ja, es kommt nicht auf die Quantität der gemeinsamen
Zeit an, sondern auf die Qualität.
Leider wissen wir auch: Das ist ein Selbstbetrug. Eine Lüge. Denn unsere Kinder kennen keine
quality time. Das Gerede von der
quality time
verschleiert nur, dass das Zeitproblem einfach ungelöst ist.
Sigmar Gabriel übrigens hatte, bevor er sich entschloss, seine Tochter
immer mittwochs aus der Kita abzuholen, auch schon mal eine Auszeit für
die Familie genommen. Drei Monate Väterzeit. Gleich in den ersten Tagen
twitterte er ein Bild von sich, vor dem Laptop sitzend, die Kaffeetasse
in der Hand: »Mariechen ist abgefüttert, der Kaffee ist da, also kann’s
losgehen :-))«. Und dann diskutierte er online eine Stunde lang über die
Rente, den Euro, die SPD. Genau das ist er doch, der tägliche
Selbstbetrug: Man glaubt, Zeit für die Kinder zu haben – und hängt dann
am Laptop, iPad oder Smartphone.
Aber warum ist es nur so verdammt schwer, Kinder und Ehe und Beruf unter
einen Hut zu bekommen? Warum sind wir erschöpft und müde und einfach
erledigt, warum haben wir ständig das Gefühl, dass wir zu wenig Zeit für
alles haben: für die Kinder, für den Job, für die Partnerin, für uns
selbst?
Sprechen wir also über Erwartungen. Auch früher gab es Erwartungen an
Väter und Mütter, aber sie waren klarer und eindeutiger, weil es auch
klare und eindeutige Rollen gab. Heute dagegen gibt es unendlich viele
Erwartungen, weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt, eine gute
Mutter und ein guter Vater zu sein, und deswegen scheint es das Beste zu
sein, einfach alle Erwartungen zu erfüllen.
Also will man der liebevollste Vater überhaupt sein; der Vater, der
immer Zeit zum Spielen hat; der die tollsten Sachen mit Lego baut; ein
Vater, der nie schimpft und schreit und niemals ärgerlich ist. Dann will
man der beste Ehemann von allen sein, der immer zuhört; der natürlich
weiß, wie man die Waschmaschine und den Trockner füllt, und der das auch
macht und auch die Hemden selber bügelt; man will wunderbar kochen und
morgens den schönsten Frühstückstisch überhaupt decken können. Man will
ein sensationeller Liebhaber sein und gleichzeitig eine starke Schulter
zum Ausweinen haben; sensibel und erfolgreich sein.
Und natürlich gilt das alles auch spiegelbildlich: Wir wollen Frauen,
die tolle Mütter sind, erfolgreich im Beruf und kulturell interessiert.
Dass sie manchmal müde sind und abgespannt und keine Topmodelhaut haben,
geschenkt. Wir verlangen ja nichts Unmögliches. Wir wollen ihren Rat,
Gespräche auf Augenhöhe, wollen an den Kabalen in ihren Agenturen, ihren
Büros genauso teilhaben wie umgekehrt. Wir wollen ihnen Freiräume für
ihre Karriere schaffen, wollen ihnen den Rücken stärken, wenn es bei
ihnen im Job brennt.
Es gibt kaum mehr Momente der Zweisamkeit und noch weniger die der Gelassenheit
Und dann? Hat man schon wieder keine Zeit, wenn die Kinder spielen
wollen; liegt die schmutzige Wäsche herum; musste die Partnerin doch
wieder einen Babysitter organisieren, weil man ausgerechnet an dem
Abend, an dem sie überraschend in ein Meeting musste, noch ein wichtiges
Hintergrundgespräch hatte; war das Frühstück ein Reinfall, weil man
nicht zugehört hatte, als die Ehefrau sagte, dass man den Namen ihrer
Chefin schon wieder verwechselt habe. Und das mit dem Sex ... ach,
lassen wir das.
Das Bedrückende daran ist nicht nur der gewaltige Stress, den all das
verursacht. Viel bedrückender ist, dass man vor lauter Erschöpfung die
Sprache verliert: dass man nicht einmal mit der Partnerin oder dem
Partner über all das reden kann, obwohl man natürlich ahnt, eigentlich
sogar weiß, dass es dem anderen genauso geht. Aber es gibt sie einfach
kaum mehr, die Momente der Zweisamkeit und, vor allem, der Gelassenheit.
Denn wann soll man sich gegenseitig erzählen, was einen so beschäftigt?
Wann soll man zuhören, Rat geben, miteinander abwägen und sich stützen?
Wann lässt man sich wirklich noch ganz aufeinander ein – ohne Ablenkung
von außen? Ohne dass im eigenen Kopf ein Sturm von Gedanken tobt, über
den Tag, über den Job, über das schlechte Gewissen und die Ausreden, die
man sich zurechtlegt, weil man wieder nicht geschafft hat, was man
unbedingt schaffen wollte?
Es gibt auch niemanden, den wir um Rat fragen können. Unsere Eltern
nicht, weil sie diese Situation nie erlebt haben, es war anders bei
ihnen, alles begann gerade erst, sich zu verändern, und es war noch
nicht so durcheinandergeschüttelt wie heute. Wir sind Pioniere, die
erste Generation, die tatsächlich versucht, Gleichberechtigung zu leben.
»Was gehen mich die Kinder an, ich mach Karriere!« – das ist für uns
keine denkbare Haltung mehr.
Wir können auch schlecht mit unseren Chefs reden, selbst wenn sie
mindestens so grau und abgearbeitet aussehen wie wir. Sie haben ein noch
brachialeres Pensum.
Und wir können keine anderen Eltern fragen, denn meistens will man bei
einem gemeinsamen Essen mit Freunden eben nicht wieder nur über Kinder
oder den Job sprechen, sondern auch mal über etwas anderes – und damit
entsteht die Illusion, dass es bei den anderen doch alles ganz gut
klappt und nur bei einem selbst nicht. Nur ganz selten, wenn es sehr
spät geworden ist und die Kinder im Bett sind und wenn schon sehr viel
Rotwein getrunken wurde, dann bricht es aus allen heraus.
Dann erzählt die Kollegin, dass sie am Wochenende nur heimlich simst, um
Kinder und Partner nicht zu verärgern; ganz so, als habe sie eine
Affäre.
Dann erzählt das befreundete Paar, beide Vollzeit, drei Kinder aus zwei
Beziehungen, wie ihnen der Sohn ins Gesicht schrie: »So wie ihr will ich
nicht leben!«
Dann gibt es Geschichten über Schlafmangel und Migräne und Bandscheibenvorfälle.
Dann erfährt man, dass es keine Familie gibt, die nicht fast permanent am Rande des Wahnsinns operiert.
In einem schönen, melancholischen Essay in der
Literarischen Welt
hat die Schriftstellerin Julia Franck gerade notiert, Schreiben und
Kinder seien im Grunde unvereinbar. »Wenn ich schreibe, kann ich nicht
mit meinen Kindern sein, und wenn ich mit meinen Kindern bin, kann ich
nicht schreiben. Dieser Zwiespalt erzeugt eine enorm hohe Spannung, weil
ich in beidem voller Hingabe lebe, beides ist Hingabe und Liebe.« Und
sie resümiert: »Man erlebt das Leben als ständiges Scheitern.«
Man müsste eine perfekte Persönlichkeitsspaltung hinbekommen, um uneingeschränkt in beiden Sphären leben zu können
Wir sind keine Schriftsteller, nur Journalisten. Aber diese Spannung,
die kennen wir auch. Und das Gefühl des Scheiterns. Alle kennen das,
Väter wie Mütter.
Eigentlich müsste man eine perfekte Persönlichkeitsspaltung hinbekommen,
um uneingeschränkt in beiden Sphären leben zu können. Ein wenig
schizophren ist es ja auch, wenn wir auf dem Kinderzimmerboden liegen,
mit Rennautos spielen und dabei aufs iPad schauen. Aber vielleicht sind
wir einfach nicht schizophren genug?
Oder sind wir bloß Weicheier, Heulsusen? Überfordert von den eigenen
Ambitionen? Kinder zu haben war ja nie leicht. Früher starben viele
Säuglinge, herrschte Hunger, Kriege verheerten das Land. Es gab
existenzielle Sorgen und Nöte, neben denen sich unsere Befindlichkeiten
heute marginal ausnehmen. Und mal ehrlich: Wir sind wohlhabende
Mittelschichtseltern. Wir brauchen keine zwei oder drei Jobs
gleichzeitig, damit wir überhaupt über die Runden kommen, so wie manch
andere Eltern in diesem Land. Wir haben keine Überlebenssorgen.
Aber Lebenssorgen sind es dennoch. Der Berliner Soziologe Hans Bertram
nennt uns »die überforderte Generation«. Nicht nur, weil wir immer so
müde sind und blass. Es gibt auch handfeste soziologische Gründe dafür,
dass wir derart unter Strom stehen. Zum einen, weil es noch nie in einer
Generation so viele Singles und kinderlose Paare gab. Deren ökonomische
Situation ist im Durchschnitt deutlich besser als die von Familien mit
Kindern, von Alleinerziehenden ganz zu schweigen. So viel Konkurrenz
produziert: Stress.
Zum anderen, weil immer mehr Frauen ihr erstes Kind um die dreißig oder
später bekommen und deswegen die zehn, fünfzehn intensivsten
(aufregendsten, schönsten) Jahre der Erziehung und der Fürsorge für die
Kinder gerade bei hoch qualifizierten Frauen und Männern exakt mit den
Jahren der ersten Karrieresprünge zusammenfallen. Bertram nennt das die
»Rushhour der Biografien«. Noch bei unseren Eltern waren diese beiden
Phasen stärker verschoben, die Zeit der Doppelbelastung also kürzer. Bei
uns bedeutet es: noch mehr Stress.
Aber was heißt das alles? Was ist die Konsequenz? Zurück in die Fünfziger, Mutti wieder an den Herd, Vati geht arbeiten?
Natürlich nicht. Dass Frauen Karriere machen, ist gut. Gut für die
Frauen, gut für die Gesellschaft. Dass Männer sich mehr um ihre Kinder
kümmern, ist auch gut. Gut für die Kinder, für die Männer und für die
Gesellschaft. Und wenn sich immer mehr Männer um ihre Kinder kümmern
wollen, erzeugt das Druck auf die Wirtschaft, flexibler zu werden. Auch
das ist gut.
Was dann? Noch mehr staatliche Interventionen, Fördermodelle? Die
Familienpolitiker lassen uns glauben, dass alles nur eine Frage von Geld
und Organisation wäre. Und dass zu den unzähligen familienpolitischen
Leistungen und den fast 200 Milliarden Euro, die der Staat jedes Jahr
für Familien ausgibt, nur ein paar weitere Leistungen hinzukommen
müssten, dann würde schon vieles besser. Sie reden von Splittingmodellen
und Teilzeitarbeit oder davon, dass der Staat die Arbeitszeit für junge
Eltern begrenzen könnte, auf 32 Stunden in der Woche. Das ist ihr
Versprechen. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass die Grenze zwischen
Arbeitszeit und privater Zeit längst durchlässig geworden ist, weil man
immer erreichbar sein muss und, ja, auch immer erreichbar sein will. Die
moderne Arbeitswelt hat sich enorm beschleunigt und gleichzeitig
verdichtet, alle erleben das. Die Familienpolitiker aber lassen einen
glauben, dass es gar nichts ausmachen würde, wenn dann noch ein Kind
dazukommt.
Weil Selbstausbeutung auch keine Lösung ist, wird eine Konsequenz längst
gezogen, jeden Tag, jedes Jahr, in aller Stille, überall in Deutschland
(und der westlichen Welt): Frauen, gerade hoch qualifizierte,
entscheiden sich gegen Kinder. Mitunter nicht bewusst, häufig (noch)
nicht endgültig, aber seit Jahren mit großer Konstanz, all den Beihilfen
und Kita-Ausbauplänen zum Trotz. Je besser ausgebildet eine junge Frau
ist, je realer ihre Chance auf eine anspruchsvolle Karriere, desto
weniger Kinder bringt sie auf die Welt. Eine Frau, die in der
Landwirtschaft arbeitet, bekommt, statistisch gesehen, 2,2 Kinder. Die
durchschnittliche Bundesbürgerin 1,2, eine Hochschullehrerin nur 1,0.
Hilfreich wäre also schlicht: Ehrlichkeit. Denn Kinder schaffen Glück,
Glück, Glück! Und: Stress, Stress, Stress! Unweigerlich. Beides.
Es gibt keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Wer es versucht mit Kindern,
Ehe und Beruf, lässt sich auf ein Abenteuer ein. Ein Abenteuer, das
Schmerzen und Zweifel und Grenzerfahrungen bringt. Viele scheitern
daran. Aber es könnte schon eine Hilfe sein, das einmal auszusprechen,
statt immer weiter die Vereinbarkeitslüge zu verbreiten. Denn auch die
produziert wieder nur: Stress.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
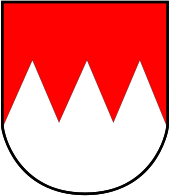
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.