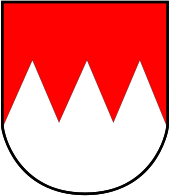Kalifornien
Aus allen Wolken gefallen
Wer nach San Francisco ging,
folgte viele Jahre dem Versprechen auf eine goldene Zukunft.
Aber jetzt entlassen Twitter und
Co. Tausende Menschen.
Sie treffen in der Stadt auf ein
Elend, vor dem sie lange wegsahen. Ein Besuch.
Von Jürgen Schmieder
23. Dezember 2022
San Francisco, Straßenecke
Market/Polk: Oben, im fünften Stock der Firmenzentrale von Twitter bastelt Elon
Musk an dem Spielzeug, das er sich für 44 Milliarden Dollar gegönnt hat, weil
er offenbar daran glaubt, dass er mit Twitter Welt und Menschheit retten wird;
oder zumindest jenen Teil von Welt und Menschheit, für den sich Musk interessiert.
Auf Twitter hat er seine mehr als
100 Millionen Follower gefragt, was das Beste im Leben sei, und ihnen dann
gesagt, dass sie etwas finden mögen, das sie wirklich glücklich mache.
Beginnen wir die Suche nach dem
Glück doch also vielleicht direkt hier; unten auf der Straße, neben der
Einfahrt in die Tiefgarage. Da steht ein junger Mann, Mitte 20; er hält ein
Pappschild hoch mit der Botschaft, dass ihn eine Umarmung von Musk glücklich
machen würde.

Foto: Jürgen Schmieder
Obwohl er bereits seit mehr als
einer Woche hier wartet, wie er sagt, hat das bislang noch nicht geklappt.
Neben ihm sitzt eine Frau, Ende 40 und ganz offenbar obdachlos; sie pinkelt auf
den Gehsteig, während die Leute ihr dabei zuschauen. Luftlinie zwischen einer der
reichsten Personen der Welt und dieser Frau: keine 50 Meter.
Man hat schon oft von diesem
enormen Kontrast zwischen extrem reich und bettelarm in dieser Stadt gehört.
Wenn man aber einmal hierherkommt, um sich anzusehen, wie das so ist, wenn der
reichste Mann der Welt Tausende Leute vor die Tür setzt, weil die seiner
Meinung nach nicht „hardcore“ genug arbeiten wollen, dann muss man sagen: In
Wirklichkeit ist alles noch viel schlimmer.
Die Überschrift eines Essays im
Sommer auf dem Portal The Atlantic: „Wie aus San Francisco eine
gescheiterte Stadt wurde.“ Die Autorin Nellie Bowles beschreibt darin das
Versprechen, das diese Stadt seit dem Goldrausch gegeben und oft auch gehalten
hat: ein besseres Leben, eine bessere Welt. Sie beschreibt auch, wie sich die
Bewohner in ihrer progressiven Selbstgerechtigkeit selbst im Weg stehen, weil
sie nicht einsehen, dass es hin und wieder auch gute konservative Ideen gibt.
Sie beschreibt, wie während des Lockdowns all das Schlechte, das man im Trubel
ums Gutsein und Weltverbessern einfach ignoriert hatte, nicht mehr übersehen
werden konnte: Vor einer 4,8 Millionen Dollar teuren Villa im Stadtteil
Japantown starb ein erst 37 Jahre alter Obdachloser, elf Stunden war er auf dem
Gehsteig gelegen, bis jemand die Polizei rief.
275
000 Millionäre leben in der San Francisco Bay Area
Vielleicht ein paar Zahlen: In
der San Francisco Bay Area, zu der auch das Silicon Valley im Süden gehört,
leben 77 Milliardäre – mehr gibt es in den USA nur in New York. Es leben hier
mehr als 600 Leute, die mehr als 100 Millionen Dollar besitzen. Dazu kommen 275
000 Millionäre. Unfassbarer Reichtum also. Nur: Man muss inzwischen eigentlich
Millionär sein, um sich diese Stadt leisten zu können.
Wer es nicht ist, geht
irgendwann. Wie Matthew Schwartz, 40, und seine fünf Jahre jüngere Frau Kira.
Sie zogen 2016 nach San Francisco; in die Straße, in der Airbnb gegründet
worden ist. Sie arbeitete als IT-Beraterin bei der Analysefirma Gartner, er bei
einer Firma, die nachhaltige Häuser baut. Gemeinsames Jahresgehalt: 300 000
Dollar. „Das ist nicht viel in einer Stadt, in der eine kleine Wohnung 4000
Dollar Miete kostet – plus 300 Dollar für eine Garage, weil in den ersten zwei
Wochen beinahe jeden Tag ins Auto eingebrochen wurde, das wir auf der Straße
geparkt hatten“, sagt er bei einem Treffen in einem Park in Los Angeles, wo er
seit 2020 wohnt: „Natürlich ist man sich bewusst, was da auf der Straße
passiert. Man begegnet anderen Leuten, und die sehen das Gleiche wie man
selbst: Leute, die sich auf dem Gehsteig eine Nadel in den Arm rammen. Die vor
allen Leuten onanieren. Die sich selbst von oben bis unten vollkacken.“
Wer glaubt, dass so was
übertrieben klingt, möge zur UN Plaza im Viertel Tenderloin gehen, fünf
Laufminuten von der Twitter-Zentrale entfernt. Jeder Ort hat einen Geruch, der
einzigartig ist. Die Münchner U-Bahn zum Beispiel: Betonstaub, vergisst man
nie. Smokey Mountain, die Slums von Manila, einer der ärmsten Orte der Welt:
Kohle, Rauch, Schweiß; vergisst man auch nie. Gäbe es einen Geruch für Elend,
wäre es dieser hier an der UN Plaza. Urin, Fäkalien,
Erbrochenes.

Foto: Michael Ho Wai Lee/imago images/ZUMA Wire

Foto: Jürgen Schmieder
Man zählt hier, auf diesem Platz,
der etwa so groß ist wie der Marienplatz in München, mehr als 300 Leute, die
auf der Straße leben.
73 davon stehen in der Schlange
für die einzige öffentliche Toilette am Platz; und man weiß, was passiert sein
muss, wenn Nummer 41 die Schlange verlässt. Es gibt auf der anderen Seite noch
ein mobiles Klo, darauf steht: „Dignity on Wheels“. Würde auf Rädern. Wie viel
Würde hat ein Mensch, der sich nicht rechtzeitig anstellt?
Vor einem Jahr hat die Stadt den
Notstand ausgerufen. Es gibt insgesamt etwa 25 000 Obdachlose in der Bay Area –
derart viele, dass sich das Problem nicht einfach mit Geld lösen ließe.
Die Stadt hat 22 Millionen Dollar
investiert in das Tenderloin Center an der UN Plaza; eine Einrichtung fürs
Notwendigste. Das Notwendigste heißt: Hilfe bei Überdosis, sanitäre
Grundversorgung; Wasser für die, die am Verdursten sind.
Nellie Bowles schreibt in ihrem
Essay: „Wenn du schon auf der Straße sterben musst, dann ist San Francisco kein
schlechter Ort dafür. Beamte und Freiwillige bringen Essen und Decken, Nadeln
und Zelte. Doktoren schauen, dass die Drogen wirken. Und sie sorgen dafür, dass
der Rest von dir okay ist, während du dieses Leben verlässt.“ Gerade eben wurde
das Tenderloin Center schon wieder geschlossen; zu teuer, es bringe nicht
wirklich was, so das Urteil von Bürgermeisterin London Breed. Nur damit die
politischen Verhältnisse geklärt sind: Seit Mitte der Sechzigerjahre ist San
Francisco in demokratischer Hand, 2020 stimmten mehr als 85 Prozent für Joe
Biden. Für die Republikaner steht das, was in San Francisco passiert,
symbolisch für die Demokraten: die Welt verbessern und jedem sagen wollen, wie
das geht – aber den eigenen Laden nicht hinkriegen. Das Schimpfwort dafür: San
Francisco Values.
Der wahnwitzige Erfolg
zahlreicher Unternehmen übertünchte die dunklen Flecken; das ist vorbei. Nicht
nur Twitter entließ Tausende Mitarbeiter – es gibt noch immer keine genaue Zahl
–, sondern auch Amazon (bis zu 10 000) und Meta (11 000). Insgesamt verloren
allein im November 35 000 Menschen in der Tech-Branche ihre Jobs, laut der Statistik-Website Layoffs gab es 2022 insgesamt 150 000 Entlassungen – und man darf nicht vergessen,
dass es in den USA keine Kündigungsfristen oder sozialen Absicherungen gibt wie
in Europa.
„Irgendwann fragt man sich: Warum
lebe ich hier“, sagt Schwartz. Natürlich sei die Stadt faszinierend: „Was für
diesen einzigartigen Vibe in San Francisco sorgt: Ehrgeiz. Wer hierherkommt,
will was erreichen, beruflich, privat.“ Es sei nie langweilig, weil man dauernd
Leute treffe, die an spannenden Projekten arbeiten und ihre Freunde zu
Abenteuern einladen: Burning Man, Konzerte, Sterne-Restaurants.
Twitter galt auch deshalb vielen
als guter Arbeitgeber, weil man in dem Moment, als in San Francisco alles so
sichtbar wurde, nicht mehr dorthin musste. Die Covid-Pandemie war für viele in
dieser Silicon-Valley-Tech-Gemeinde eine Befreiung. Viele zogen weg, in
günstigere Städte, oftmals auch in andere Bundesstaaten, und Twitter gehörte zu
den Unternehmen, die auch gegen Ende der Pandemie den Angestellten erlaubten,
weiter im Home-Office zu bleiben. Gründer Jack Dorsey sagte gar: „Für immer.
Dann kam Musk.
Zunächst schrieb er in einer
E-Mail an alle, die er davor nicht gefeuert hatte, dass er von ihnen erwarte,
dass sie pro Woche mindestens 40 Stunden im Büro sein würden; kurz darauf
schrieb er: Wer „außergewöhnliche“ Arbeit leiste, könne im Home-Office bleiben;
der Vorgesetzte übernehme die Verantwortung dafür: „Auch aufs Risiko hin, das
Offensichtliche zu sagen: Jeder Manager, der fälschlich behauptet, ein
Untergebener sei grandios oder seine Rolle unverzichtbar, wird rausgeworfen.“
Mit
einem Jahresgehalt von weniger als 117000 Dollar gilt man hier als
Unterschicht.
Man könnte natürlich sagen: Musk
treibt seine Leute eben an. Man könnte aber auch sagen: Er greift massiv ins
Leben derer ein, die aufgrund der früheren Firmenpolitik anders geplant hatten
– und womöglich auch ein Gehalt akzeptierten, mit dem sie dort, wo sie im
Home-Office lebten, leben konnten. Musk forderte eine Rückkehr ins Büro nach
San Francisco. Hardcore, und dadurch erscheint ein anderes Detail der
Tech-Branche in komplett anderem Licht.
Tech-Konzerne sind berühmt dafür,
dass sie Mitarbeitern großzügige Extras gewähren: Gratis-Essen, Gratis-Kaffee
oder Gratis-Wäscherei. Man redet über diese Annehmlichkeiten bisweilen, als
dienten sie einzig dazu, die Mitarbeiter zu motivieren oder sie ein wenig
länger im Büro zu fesseln. Was man vergisst: Sie sind für viele
lebensnotwendige Zulagen. Ohne sie könnten sie sich das Leben in San Francisco
ganz einfach nicht leisten.
In Zahlen: Das Massachusetts
Institute of Technology berechnet regelmäßig den Stundenlohn, der nötig ist, um
in einer US-Stadt zu überleben. Ja, überleben, es sind nur die
notwendigen Ausgaben berechnet. In San Francisco sind für kinderlose Singles
30,81 Dollar nötig, mehr als das Doppelte des gesetzlichen Mindestlohnes. Aufs
Jahr gerechnet, wie es die Analysefirma Marketwatch getan hat: Wer in San
Francisco 100 000 Dollar im Jahr verdient und wirklich nur das absolut Nötigste
ausgibt, macht am Ende 2734 Dollar Verlust. Mit einem Jahresgehalt von weniger
als 117000 Dollar gilt man hier als low income – als Unterschicht.

Foto: Twitter page of Elon Musk/AP
Musk fordert von
Twitter-Angestellten, dass die hardcore sein müssten für: ja, wofür eigentlich?
Er lieferte sich auf Twitter eine Fehde mit dem Entwickler Eric
Frohnhoefer. Es ging um Arbeit und Ahnung; irgendwann ging es um
Annehmlichkeiten wie Gratis-Mittagessen. Zuletzt schrieb Musk über Frohnhoefer
auf Twitter: „He’s fired.“ Hardcore.
Frohnhoefer ist mittlerweile in
San Diego, er hat nach dem Rauswurf erst einmal Urlaub gemacht und sortiert nun
Angebote. Auch das ist typisch fürs Silicon Valley: Ja, man kann von heute auf
morgen entlassen werden, aber gerade Leute in der Tech-Branche wissen, dass sie
auch sehr schnell einen neuen Job finden werden. Angst vor dem Rauswurf hat
deshalb kaum jemand. Am Telefon sagt Frohnhoefer zur SZ über die Branche: „Sie
zahlen einen Haufen Geld für…“ Lange Pause, er wird den Satz nicht
vervollständigen, und man denkt sich: Ja, wofür eigentlich? Klar, die
wunderbaren Aspekte von Twitter sollen nicht verleugnet werden – aber: Es gibt
dann schon auch noch Elend auf der Welt, auch direkt vor der Twitter-Haustür.
Auch das ist ja eine Frage an
Musk: Keines seiner Autos kostet ohne Steuervergünstigungen weniger als 47 000
Dollar – plus Steuern und Gebühren. Er baut recycelbare Raketen. Er verkauft
Flammenwerfer und baut Tunnel wie den in Las Vegas, in dem ein Autopilot-Tesla
(noch ist ein Fahrer nötig) Leute vom Hotel zum Konferenzzentrum bringt. Nun
will er als, wie er sich selbst nennt, „Absolutist der freien Meinungsäußerung“
Twitter revolutionieren.
Schwartz
verließ die Stadt, nachdem unten auf der Straße eine Frau unter Drogen eine
halbe Stunde wirres Zeug redete
Wie in aller Welt hilft er damit
der Frau, die direkt unter seinem Twitter-Büro auf die Straße pinkeln muss,
weil es sonst keine andere Möglichkeit für sie gibt? San Francisco Values.
„Es ist die Stadt mit der
niedrigsten Geburtenrate aller Metropolen in den USA“, erzählt Schwartz. Es
komme für viele der Moment, in dem man die negativen Aspekte nicht mehr
ausblenden kann. Für Schwartz war das: „Wir saßen auf dem Balkon, und dann
hörten wir unten eine Frau, die offenbar Drogen genommen hatte und eine halbe
Stunde lang in Schmerzen wirres Zeug brüllte. Meine Frau und ich waren uns
einig: Hier wollen wir keine Kinder haben.“ Sie zogen während der Pandemie 2020
nach Los Angeles, weil es dort – und das ist schon ein Statement –
billiger und kinderfreundlicher sei als in San Francisco.
Das Volkszählungsamt Bureau of
the Census veröffentlichte Mitte Oktober eine Umfrage, der zufolge 7,6 Prozent
der Bewohner von San Francisco im kommenden Jahr in eine andere Stadt ziehen
wollen – Platz eins mit ansehnlichem Vorsprung vor zum Beispiel Los Angeles
(5,8 Prozent), New York (3,2) und sogar Detroit (6,6).
„Ich will nicht zu sehr auf San
Francisco schimpfen“, sagt Schwartz. Aber sein Lebensentwurf – er wollte Mitte
30 eine Familie gründen (mittlerweile hat er zwei Kinder) und ein Haus besitzen
(tut er nun im Süden von L.A.) – passte nicht mehr in diese Stadt: „Wenn jemand
direkt von der Uni ein sechsstelliges Gehalt für einen spannenden Job bei einem
Start-up geboten kriegt: Warum nicht?“
Heißt übersetzt: Der Ehrgeiz wird
weiterhin gerade junge Leute ins Silicon Valley und speziell nach San Francisco
führen. Die Welt, zumindest die, für die man sich interessiert, zu einem
besseren Ort machen. Dafür ein sechsstelliges Gehalt und Aktien kassieren.
Dafür muss man nur bereit sein, auf dem Spaziergang vom Twitter-Firmensitz zum
400-Dollar-Dinner Leuten zu begegnen, denen nichts anderes übrig bleibt, als
auf dem Gehsteig zu schlafen. Aus dem Twitter-Firmensitz hat sich inzwischen
auch Elon Musk noch einmal über seinen Account gemeldet, er wolle den Mann, der
offenbar seit Längerem unten mit einem Pappschild steht und darauf wartet, von
ihm umarmt zu werden, nun tatsächlich – umarmen.
Scott McKenzie hat 1967, als San
Francisco mehr Utopie war als wirklicher Ort, darüber gesungen, dass man sich
Blumen ins Haar stecken solle, wenn man hierherkommt. Heute, 2022, braucht man
vor allem eines: Scheuklappen.
Team
Text Jürgen Schmieder
Bildredaktion Natalie Neomi Isser
Digitales Storytelling Wolfgang Jaschensky